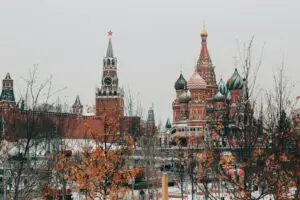Donald Trumps aktuelle Handelspolitik wirkt auf den ersten Blick chaotisch – Zölle gegen Verbündete und Rivalen gleichermaßen, scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber Kursstürzen an der Börse. Viele fragen sich: Hat dieser Mann überhaupt einen Plan? Überraschenderweise lautet die Antwort Ja. Trumps neues Wirtschaftsteam – allen voran Schatzamtssekretär Scott Bassett und Chefökonom Stephen Miran – verfolgt eine Drei-Phasen-Strategie, um die globale Wirtschaftsordnung zugunsten der USA umzukrempeln. Bassett spricht davon, Länder in drei Gruppen einzuteilen: grün, gelb und rot. Grüne Länder (enge Partner der USA) sollen niedrige Zölle, Sicherheitsgarantien und bevorzugten Zugang zum US-Dollar-System erhalten, während rote Länder (Gegner) „auf sich allein gestellt“ bleiben – also keinen Sonderzugang und eher hohe Handelshürden haben. Dazwischen liegen gelbe Länder mit einem Zwischenstatus. Diese neue Einteilung erinnert an frühere US-geführte Ordnungen (Bretton-Woods-System, neoliberale WTO-Ära) und soll Amerikas Interessen künftig wieder in den Mittelpunkt stellen.
Warum dieser radikale Ansatz? Bassett und Miran sehen die Deindustrialisierung der USA als existenzielle Bedrohung. In den 1950ern trug die verarbeitende Industrie noch rund 28% zur US-Wirtschaftsleistung bei; heute sind es nur etwa 10%. Diese Erosion der industriellen Basis hat ganze Regionen („Rust Belt“) wirtschaftlich abgehängt – Gebiete, die 2024 maßgeblich für Trumps Wahlsieg stimmten. Zudem liegt die industrielle Kapazität der USA weit hinter der Chinas, was im Krisen- oder Kriegsfall zur Achillesferse werden könnte. Trumps Team will die USA daher re-industrialisieren und zugleich die Vorherrschaft des US-Dollars als Weltreservewährung bewahren. Viele Ökonomen halten diese Kombination für unmöglich (eine starke Industrie erfordert normalerweise eine schwächere Währung, was dem Dollar-Reserveprivileg widerspricht). Doch Trumps Berater glauben, das Unmögliche möglich zu machen. Ihr Masterplan besteht aus drei Schritten, die wir nun im Detail betrachten.
Trumps Drei-Phasen-Plan: Vom Zollchaos zum „Mar-a-Lago-Abkommen“
Trumps Wirtschaftsagenda lässt sich in drei Phasen gliedern, die aufeinander aufbauen und gemeinsam einen neuen US-zentrierten Weltwirtschaftsrahmen bilden sollen :
Phase 1: Zollchaos als Verhandlungspfand. In der aktuellen Anfangsphase überzieht die Administration Freund und Feind mit hohen Schutzzöllen. Dieses „Zollchaos“ signalisiert, dass es Trump ernst ist: Er nimmt auch kurzfristige wirtschaftliche Schmerzen (z.B. Börsenturbulenzen oder teurere Importe) in Kauf, um andere Länder an den Verhandlungstisch zu zwingen. Bassett bestätigte, Trump nutze Zölle inzwischen gezielt als Druckmittel in Verhandlungen – selbst gegenüber traditionellen Partnern. Stephen Miran betonte vor seinem Regierungsamt, der Dollar-Umbau könne erst nach einer Phase hoher Zölle erfolgen, sobald genügend Verhandlungsmacht aufgebaut sei. Mit anderen Worten: Die derzeitigen Konflikte sind bewusst entfacht, um später bessere Deals zu erzwingen. Trump demonstriert maximale Härte (“America First”), um Länder aus ihrer Komfortzone zu holen.
Phase 2: Reziproke Zölle – „Level Playing Field“. Im nächsten Schritt strebt das Team Gegenseitigkeit in den Handelsbeziehungen an. Reziproke Tarife bedeuten, dass die USA gegenüber jedem Land genau die gleichen Zollsätze anwenden würde, die dieses Land auf US-Waren erhebt. So sollen jahrzehntealte Ungleichgewichte beseitigt werden. Tatsächlich durften viele Länder im Rahmen der WTO bislang höhere Zölle gegen die USA setzen als umgekehrt. Künftig soll gelten: gleiches Recht für alle. Hebt Land X seine Abgaben an, zieht die USA sofort nach – ein ständiges Wettrüsten lohnt sich nicht mehr. Ziel ist ein ebener Spielplatz, auf dem sich Wettbewerbsfähigkeit und Rechtsstaatlichkeit auszahlen, statt wie bisher niedrige Löhne, Währungsmanipulation oder Technologiediebstahl Vorteile bringen. Kritiker warnen allerdings, dass solche umfassenden Handelskriege historisch oft alle Seiten schädigten (man denke an die 1930er Jahre) und politische Spannungen bis hin zu Konflikten schürten. Trumps Berater entgegnen, die USA säßen am längeren Hebel: Weil fast alle Länder auf den US-Markt angewiesen seien, könnten sie es sich nicht leisten, ewig mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. In der Tat hat China auf Trumps erste Zollrunde 2018 ausgewichen, indem es seine Exporte über Drittstaaten (z.B. Mexiko, Vietnam) in die USA schleuste. Diesmal jedoch wurden globale Zölle eingeführt, um solche Schlupflöcher zu schließen. Die Botschaft: Kein Land kann dem US-Druck entkommen – letztlich wird es einem Deal zustimmen müssen, der faire(re) Bedingungen schafft.
Phase 3: Ein neues Währungsabkommen („Mar-a-Lago-Accord“). Hat Trump erst genügend Druck aufgebaut, soll ein großer diplomatischer Wurf folgen – ein internationales Währungs- und Handelsabkommen, scherzhaft als „Mar-a-Lago-Abkommen“ bezeichnet. In Anlehnung an die historischen Vereinbarungen von Bretton Woods (1944) und dem Plaza-Abkommen (1985) schwebt dem Trump-Team ein Pakt vor, der den US-Dollar gezielt abwertet, ohne seinen Reservewährungsstatus zu verlieren. Konkret könnte dies bedeuten, dass verbündete „grüne“ Länder ihre Währungen an den Dollar koppeln und im Bedarfsfall aufwerten, sobald der Dollar zu stark wird. Durch diese koordinierte Steuerung bliebe der Dollar schwächer, US-Produkte wären international günstiger, und die chronischen Handelsdefizite der USA würden sinken. Im Gegenzug bekämen die Partner Länder bevorzugten Zugang zum riesigen US-Verbrauchermarkt, zur amerikanischen Finanzinfrastruktur (Dollar-Liquidität) und US-Sicherheitsgarantien – ähnlich wie im alten Bretton-Woods-System. Allerdings sollen sie dafür auch „Tribut“ zahlen, etwa die Kosten für US-Militärschutz mittragen, was ihre Rolle zu der von Vasallenstaaten degradieren würde, wie ein Analyst nüchtern anmerkt. Offiziell hat die Regierung dieses Szenario noch nicht verkündet – Miran hält sich zu Details bedeckt, um Verhandlungen nicht vorwegzunehmen. Doch die Stoßrichtung ist klar: Dollar schwächen, aber behalten. Folglich versucht man durch einen Dollar-Abwertungs-Pakt das Beste aus zwei Welten zu erreichen: Die Wettbewerbsfähigkeit einer schwächeren Währung und weiterhin das Privileg, die Weltleitwährung zu stellen.
Zusammenspiel der Phasen: Phase 1 (Zollschock) schafft die nötige Verhandlungsmasse, Phase 2 (Reziprozität) institutionalisiert fairere Handelsregeln, und Phase 3 krönt das Ganze mit einer neuen Währungsordnung, die US-Industrie und Hegemonie zugleich stützt. Bassett betont, man müsse Handel, Währung und Sicherheit verzahnt betrachten – genau das tue Trump, indem er die internationale Ordnung neu ordnet im Interesse des amerikanischen Volkes. Allerdings hängt alles daran, dass genügend Länder bereit sind, bei diesem neuen System mitzumachen. Hier liegt die größte Unsicherheit: Kann Trump genug Vertrauen und Anreize schaffen, damit andere Staaten sich diesem US-zentrierten Ordnungssystem freiwillig anschließen?
Historische Einordnung: Von Bretton Woods zum neoliberalen System
Trumps Strategie steht in einer Traditionslinie früherer großer Neuordnungen der Weltwirtschaft durch die USA. Tatsächlich hat Washington den globalen Rahmen bereits zweimal grundlegend umgestaltet: nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Bretton-Woods-System und in den 1980er Jahren mit der neoliberalen Weltordnung von Freihandel und flexiblen Märkten. Um die heutige Situation zu verstehen, lohnt ein Blick auf diese Präzedenzfälle:
Bretton Woods (ca. 1944–1973): Auf der Konferenz von Bretton Woods 1944 schufen die Alliierten unter US-Führung ein regelbasiertes Finanzsystem. Für alle Länder außer den USA bedeutete eine Teilnahme im Wesentlichen drei Dinge :
Fixierung der eigenen Währung an den US-Dollar, der seinerseits an Gold gebunden war (fester Wechselkurs).
Sicherheitsgarantien der USA – viele Staaten traten militärischen Allianzen wie der NATO bei und stationierten US-Truppen, um Schutz vor der sowjetischen Bedrohung zu erhalten.
Wirtschaftliche Aufbauhilfe und Marktzugang: Die USA öffneten großzügig ihren Heimatmarkt für Exporte der Partner und unterstützten deren Wiederaufbau (z.B. Marshallplan-Hilfen). Im Gegenzug durften diese Länder ihre eigenen Märkte zeitweise vor US-Konkurrenz schützen, bis ihre Industrien wettbewerbsfähig waren.
Nur verbündete (grüne) Länder genossen all diese Vorteile. Neutrale Staaten konnten einzelne Abkommen schließen, erhielten aber kein Rundum-Paket. Kommunistische Länder (damals „rote“) waren praktisch ausgeschlossen aus der westlich dominierten Wirtschaftsordnung. Auf den ersten Blick scheint Bretton Woods für die Partner ein besseres Geschäft gewesen zu sein als für die USA – schließlich erlaubten die Vereinigten Staaten anderen einen geschützten Aufbau ihrer Industrie. Doch die USA verfolgten kluge eigene Interessen: Sie wollten um jeden Preis eine weitere Weltwirtschaftskrise und neue Weltkriege verhindern. Wohlstand in Europa und Japan sollte kommunistischer Ideologie den Nährboden entziehen und zuverlässige Verbündete im Kalten Krieg schaffen . Zudem profitierten auch US-Exporteure vom Aufschwung der Alliierten. Am wichtigsten aber: Bretton Woods machte den US-Dollar zur unangefochtenen Leitwährung. Durch die Rolle als globale Reservewährung genossen die USA das, was Frankreichs Finanzminister Valéry Giscard d’Estaing einst das „exorbitante Privileg“ nannte. Länder hielten enorme Dollarreserven, was den USA erlaubte, dauerhaft über ihre Verhältnisse zu leben, sprich mehr zu importieren und Dollars auszugeben, als sie exportierten – ohne sofort in eine Währungskrise zu laufen. Dieses Privileg hatte allerdings eine Kehrseite: das Triffin-Dilemma . Weil die Weltwirtschaft immer mehr Dollar als Reserve verlangte, musste die US-Notenbank entweder die Dollar-Menge stark ausweiten (und damit das Goldversprechen untergraben) oder die Dollar-Geldmenge begrenzen (wodurch der globale Handel gebremst würde). In den 1960ern wuchs der internationale Dollar-Bedarf so stark, dass das System ins Wanken geriet. 1971 zog Präsident Nixon die Notbremse und löste die Dollar-Gold-Bindung („Nixon-Schock“). Das Bretton-Woods-System brach schließlich zusammen, was in den 1970ern zu heftigen Währungsturbulenzen und Wirtschaftskrisen führte.
Neoliberale Weltordnung (ca. 1980er–2016): Ab den 1980ern etablierten die USA – angeführt von Reagan und Englands Margaret Thatcher – ein flexibleres, marktorientiertes System. Seine Grundpfeiler: Abbau von Zöllen, Liberalisierung von Kapitalströmen, flexible Wechselkurse und die Ausweitung des US-Sicherheitsversprechens auch auf ehemals neutrale Staaten. Im Gegensatz zu Bretton Woods gab es keine formelle Abmachung mehr, dem Dollar zu folgen; die meisten Länder wählten ihn aber ohnehin freiwillig als Stabilitätsanker. Über die neue Welthandelsorganisation (WTO) sicherte sich fast jeder Staat, der „nach den Regeln spielte“, Zugang zum attraktiven US-Markt und zum Dollar-Finanzsystem. Die USA gewährten also vielen zusätzlichen Ländern einen grünen Status – selbst einstige Gegner wie China konnten ab 2001 (WTO-Beitritt) von offenen Märkten profitieren. Im Gegenzug blieb der Dollar als dominante Reservewährung unangefochten und die USA behielten die Kontrolle über das Weltfinanzsystem. Durch frei flottierende Wechselkurse verstärkte sich das Dollar-Privileg sogar: Kapital strömte in den „sicheren Hafen“ USA, trieb den Dollarkurs oft über sein handelspolitisch ausgeglichenes Niveau. Die Folge war ein sehr starker Dollar, der den Amerikanern billige Importe und hohe Kaufkraft bescherte – und die Finanzierung einer weltweiten US-Militärpräsenz erleichterte. Kehrseite: Für die US-Industrie bedeutete der teure Dollar einen Wettbewerbsnachteil. Arbeitsplätze in der Fertigung wanderten in Länder mit günstigeren Löhnen ab. Insbesondere nach Chinas Aufstieg zur „Werkbank der Welt“ erlitt die amerikanische Industrie einen Schock und viele Fabriken schlossen. Zwar wuchs die US-Wirtschaft insgesamt weiter (getrieben von Dienstleistung und Technologie), doch die Einkommensungleichheit stieg – gut situierte Amerikaner profitierten vom starken Dollar und billigen Konsumgütern, während Industriearbeiter ihre Jobs verloren. Die soziale und regionale Spaltung nahm zu. Diese Entwicklungen bereiteten politisch den Boden für Trumps protektionistische Agenda: 2016 gewann er die Wahl mit dem Versprechen, Freihandel neu zu verhandeln und das industrielle Herz Amerikas wiederzubeleben.
2016–2020: Erste Abkehr vom Freihandel. Trumps erste Amtszeit markierte das offizielle Ende der neoliberalen Handelspolitik. Mit dem Handelskrieg 2018/19 verabschiedete sich erstmals ein US-Präsident vom Dogma, dass Freihandel immer gut sei. Trump verhängte Zölle vor allem gegen China, um das riesige Handelsdefizit zu reduzieren und Fabriken zurück ins Land zu holen. China konterte jedoch mit Gegenmaßnahmen, sodass letztlich beidseitig wieder Zölle bestanden – und Peking am Ende immer noch höhere durchschnittliche Zölle aufwies als Washington. Die erhoffte Reindustrialisierung blieb aus; US-Importe verschoben sich einfach teilweise auf andere asiatische Länder. Gleichzeitig wuchs Chinas Hightech-Industrie weiter (z.B. E-Auto-Produktion), was amerikanische und europäische Branchen herausfordert. Präsident Biden versuchte daraufhin ab 2021 einen anderen Weg: umfangreiche Industriesubventionen (etwa für Halbleiter und E-Mobilität) sollten Fertigung zurücklocken. Tatsächlich entstanden neue Werke in den USA, jedoch zum Preis enormer Staatsausgaben und Defizite. Bassett und Miran kritisierten, diese Politik sei nicht dauerhaft tragfähig – sie glauben statt dessen an handelspolitische Hebel und eine Währungsanpassung, um das Problem an der Wurzel anzugehen.
Angesichts dieser Vorgeschichte erscheint Trumps neuer Dreiphasen-Plan wie der versuch einer dritten großen Neuordnung. Ähnlich wie 1944 und 1985 sollen Handel und Währungen neu justiert werden, um das System für die USA vorteilhafter zu gestalten. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied: Das Vertrauen der Partner in die Verlässlichkeit der USA ist heute erschüttert. In den 1940ern galt Amerika als Garant von Stabilität und Wiederaufbau – viele Staaten schlossen sich daher Bretton Woods an. In den 1980ern waren die USA zwar hart in Verhandlungen (Plaza Accord, Druck auf Japan/EU zur Aufwertung), aber sie agierten innerhalb eines grundsätzlich kooperativen Rahmens. 2025 hingegen herrscht Misstrauen: Die USA haben kürzlich eigenhändig Abkommen gekündigt (etwa das Nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA/USMCA) und mit Zollkeulen sogar langjährige Verbündete vor den Kopf gestoßen. Trump hat im Eifer des Gefechts Verbündete auch verbal brüskiert – er erklärte z.B., freundliche Nationen hätten die USA oft schlimmer ausgenutzt als feindliche. Solche Signale nähren Zweifel, ob die neue US-Strategie auf fairer Partnerschaft beruht oder bloß auf Erpressung. Die historische Erfahrung zeigt: Eine stabile Weltwirtschaftsordnung braucht ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen. Genau hier dürfte Trumps Plan seine größte Hürde finden.
Bewertung der Strategie: Aktuelle Daten, Reaktionen und Aussichten
Die MAGA-Strategie (Make America Great Again) ist zweifellos ambitioniert. Doch wie realistisch sind ihre Annahmen und Ziele? Im Folgenden beleuchten wir zentralen Punkte faktenbasiert und schauen auf erste Reaktionen wichtiger Akteure:
Kann der US-Dollar geschwächt werden und doch Leitwährung bleiben?
Ein Kernziel von Trumps Plan ist es, den US-Dollar abzuwerten, um amerikanische Exporte wettbewerbsfähiger zu machen – ohne die Vorteile der Dollar-Dominanz aufzugeben. Historisch erscheint das wie die Quadratur des Kreises, denn eine Leitwährung genießt ihr Ansehen gerade wegen ihrer Stabilität und Stärke. Eine gezielte Schwächung könnte Vertrauen unterminieren. Dennoch gibt es Vorbilder: 1985 etwa einigten sich die USA, Japan und Deutschland im Plaza-Abkommen darauf, den überbewerteten Dollar kontrolliert fallen zu lassen. Die US-Währung verlor in zwei Jahren rund 50% zum Yen und Mark, behielt aber natürlich ihren Status als globale Reservewährung. Trumps Berater sehen hierin einen Beleg, dass ein koordiniertes Abwerten machbar ist. Tatsächlich behaupten sie, die USA könnten „den Kuchen haben und essen“ – sprich Reindustrialisierung und Reservewährungs-Privileg gleichzeitig erreichen .
Doch die Rahmenbedingungen heute sind komplizierter als in den 1980ern. Zum einen ist die Weltwirtschaft fragmentierter: Neue Wirtschaftsmächte wie China haben eigene Ambitionen und Währungen. Zum anderen halten nach Jahrzehnten der Globalisierung unzählige Akteure Dollar-Reserven – von Zentralbanken über Ölkonzerne bis zu Schwellenländern mit Dollar-Schulden. Ein starker Vertrauensverlust in den Dollar könnte zu Kettenreaktionen führen (Kapitalflucht, Zinsschocks). Andererseits zeigen aktuelle Daten, dass der Dollar bislang nichts von seiner Vorrangstellung eingebüßt hat. Laut einer Studie des Atlantic Council blieb der US-Dollar auch 2024 unangefochten die wichtigste Reservewährung – weder Euro noch die BRICS-Staaten konnten die globale Dollar-Nachfrage merklich reduzieren. Ende 2024 hielten Notenbanken knapp 58% ihrer Währungsreserven in US-Dollar, weit mehr als in Euro (~20%) oder Yen (~5%) . Diese Dominanz verschafft den USA enorme Finanzmacht: US-Staatsanleihen gelten als sicherer Hafen, was es Washington erlaubt, selbst hohe Defizite relativ billig zu finanzieren.
Trump setzt darauf, dass kooperative Abwertungen das Vertrauen nicht zerstören, weil alle beteiligten Länder ein gemeinsames Interesse verfolgen: nachhaltigere Handelsbilanzen. Dennoch warnen Ökonomen, es sei ungewiss, ob die Strategie aufgeht. Ähnliche Versuche sollten heute schwieriger werden – die globale Finanzlandschaft ist komplexer und vernetzter, wodurch unvorhergesehene Nebenwirkungen drohen. Sollte Trump unilateral am Dollar drehen (z.B. durch Strafsteuern für Dollarnutzer, wie Miran einst vorschlug), könnten Investoren das Weite suchen. Schon die Diskussion über eine politisch motivierte Dollar-Schwächung könnte andere Großmächte motivieren, ihre Reserven stärker zu diversifizieren – etwa mehr Gold zu kaufen (China, Russland und sogar Indien haben in den letzten Jahren ihre Goldbestände aufgestockt). Wichtig ist auch: Der Dollarwert hängt nicht nur vom Weißen Haus ab, sondern von der US-Konjunktur und Zinspolitik. 2024 hatte die US-Notenbank die Zinsen erhöht, was den Dollar zwischenzeitlich stark aufwertete; Anfang 2025 gab der Dollar-Index jedoch um etwa 4% nach, als die Märkte die neuen Handelskonflikte einpreisten. Diese Schwankungen zeigen, wie sensibel die Währung auf Wirtschaftsdaten reagiert.
Eine behutsame Dollar-Abwertung mit internationaler Absprache (à la Mar-a-Lago-Accord) erscheint theoretisch möglich, wenn genug Partner mitspielen. Der Dollar bliebe Reservewährung, solange keine attraktive Alternative in Sicht ist – und die ist derzeit nicht erkennbar. Doch die Gratwanderung ist riskant. Sollte das Vertrauen in die Führung der Fed oder die Solidität der US-Finanzen schwinden, könnte das Pendel umschlagen. Noch jedoch ist der „Greenback“ das unangefochtene Rückgrat des weltweiten Finanzsystems, und Trump weiß, dass er dieses Ass im Ärmel behalten muss.
Reaktionen aus China und Indien: Konfrontation vs. Kooperation
Die unmittelbaren Reaktionen der beiden asiatischen Großmächte – China und Indien – auf Trumps neue Ausrichtung fallen sehr unterschiedlich aus, was deren strategische Kalküle widerspiegelt.
China reagiert ablehnend und konfrontativ. Bereits Trumps erste Zoll-Offensive beantwortete Peking im Gleichschritt mit Gegenzöllen. Als Washington im April 2025 nun flächendeckende Strafzölle ankündigte (durchschnittlich 54% auf chinesische Waren), konterte China umgehend mit eigenen Abgaben von zunächst 34% auf US-Importe. Dieser Satz könnte weiter steigen – Berichten zufolge erwägt Beijing Erhöhungen auf bis zu 84% oder sogar dreistellige Raten, um maximale Druckwirkung zu erzielen. Da China jedoch viel mehr in die USA exportiert als umgekehrt, kann es den Handelskrieg nicht symmetrisch führen. Peking fokussiert seine Gegenmaßnahmen daher strategisch: Es zielt auf US-Branchen, die Trumps politische Basis schmerzen – etwa landwirtschaftliche Produkte aus republikanischen Hochburgen. Gleichzeitig bemüht sich China, alternative Exportmärkte zu erschließen und die regionale Wirtschaftsintegration voranzutreiben, um die Abhängigkeit vom US-Markt zu senken. So treibt es Handelsabkommen im asiatisch-pazifischen Raum voran (etwa das RCEP) und investiert in seine Neue Seidenstraße, um neue Absatzwege nach Europa, Afrika und Lateinamerika zu schaffen. Auch währungspolitisch versucht Beijing, den Einfluss der USA zu verringern: Seit der globalen Finanzkrise 2008 internationalisiert China schrittweise den Renminbi – es hat Swap-Abkommen mit Dutzenden Ländern geschlossen, um Handelsabrechnungen in Yuan zu ermöglichen. Allerdings bleibt der Yuan-Erfolg überschaubar: Sein Anteil an globalen Zahlungsströmen und Reserven ist noch gering (2–3%). Dennoch arbeitet China mit Partnern (z.B. Russland) an Alternativen zum Dollar-basierten Zahlungssystem (Stichwort BRICS-Kooperation). Insgesamt zeigt sich: China hat keinerlei Interesse, sich dem von Trump skizzierten US-zentrischen System anzuschließen. Stattdessen versucht es, eine Gegenmacht zu formen – oder zumindest so viel Autonomie wie möglich zu gewinnen. Offizielle Verlautbarungen aus Beijing und Moskau verurteilen die US-Zollpolitik als „Gefahr für die Weltwirtschaft“ und warnen, Amerika könne sich damit ins eigene Fleisch schneiden. Als Trump den BRICS-Staaten unlängst offen mit 100% Strafzöllen drohte, falls sie eine eigene Reservewährung vorantreiben sollten, konterte Russland, ein solcher Zwang würde „nach hinten losgehen“. China selbst dürfte – wie schon im ersten Handelskrieg – langfristig auf Durchhaltefähigkeit setzen. Präsident Xi Jinping hat intern signalisiert, dass man niemals nachgeben werde, selbst wenn das bedeute, schwierige Jahre zu überstehen. Diese Haltung untermauert China durch eine Mischung aus Gegenmaßnahmen und demonstrativer Stärke (z.B. Militärmanöver, um die USA an anderen Fronten unter Druck zu setzen).
Indien hingegen schlägt einen beinahe entgegengesetzten Kurs ein. Neu-Delhi sieht in Trumps Politik weniger eine Bedrohung als vielmehr eine Chance. Indiens Exportwirtschaft konnte bislang nicht so stark in den US-Markt vordringen wie Chinas – u.a. wegen Indiens eigener Zurückhaltung bei Freihandelsabkommen. Doch nun, da chinesische und vietnamesische Anbieter mit massiven 54% bzw. 46% US-Zöllen belegt werden, sind indische Produkte (26% US-Zoll) plötzlich relativ wettbewerbsfähiger geworden. Diese Lücke möchte Indien nutzen. Premierminister Narendra Modi traf Trump im Februar 2025 in Washington; beide Länder kündigten an, zügig an einem bilateralen Handelsabkommen zu arbeiten. Erste Verhandlungsrunden liefen bereits im Frühjahr (indische Minister in Washington und US-Emissäre in Delhi). Ziel ist es, in einem „ersten Kapitel“ bestimmte Sektoren zu liberalisieren, um Indiens Zugang zum US-Markt zu verbessern – möglichst noch bis Herbst, bevor Trump eventuell Indien besucht. Zusätzlich halten die USA und Indien an einer strategischen Technologie-Allianz fest. Bereits unter Biden startete 2023 die Initiative iCET (Critical and Emerging Technologies), die gemeinsame Projekte in KI, Halbleitern, Rüstung und Raumfahrt anstoßen sollte. Trump hat zwar viele Biden-Programme eingestampft, aber iCET in abgewandelter Form als „TRUST“ (Transforming the Relationship Using Strategic Technologies) weitergeführt. Dies signalisiert, dass Washington Indien als Schlüsselpartner im technologischen und geopolitischen Wettbewerb mit China betrachtet. Indiens Regierung wiederum ist bemüht, ein positives Verhältnis zu den USA zu bewahren – gerade weil China als Nachbar und Rivalen wahrgenommen wird. Außenminister Subrahmanyam Jaishankar stellte kürzlich klar, Indien habe „absolut kein Interesse, die Rolle des US-Dollars zu untergraben“, vielmehr sehe man den Dollar als Stabilitätsfaktor der Weltwirtschaft. Diese Aussage – bemerkenswert für ein BRICS-Mitglied – verdeutlicht Indiens pragmatischen Ansatz. Delhi will vom US-Markt und Kapital profitieren und gleichzeitig seine strategische Autonomie wahren, indem es auch mit anderen Mächten (einschließlich China) im Gespräch bleibt. So hat Indien zwar die Idee einer BRICS-Gemeinschaftswährung kühl abblitzen lassen, beteiligt sich aber durchaus an Bemühungen, den Handel in Lokalwährungen zu erleichtern (z.B. Zahlung Rupee-Ruble für russisches Öl). Insgesamt positioniert sich Indien also eher im „gelben“ Bereich mit starker Tendenz zu „grün“: Man möchte bevorzugter Partner der USA werden, ohne alle Brücken nach Eurasien abzubrechen. Für Trump ist Indien ein idealer Kandidat im neuen System – eine große Demokratie, wirtschaftlich aufstrebend, anti-chinesisch eingestellt und bereit, Dollar-Hegemonie nicht in Frage zu stellen.
Wer schließt sich dem neuen System an – und wer nicht? (Grün, Gelb, Rot)
Ob Trumps Vision eines grün-gelb-roten Systems Realität wird, hängt davon ab, wie andere Länder darauf reagieren. Erste Anzeichen deuten auf eine gespaltene Welt hin: Einige sind zur Kooperation bereit (wenn auch zähneknirschend), andere suchen nach Alternativen.
Zur Veranschaulichung fasst die folgende Tabelle die drei Länderkategorien und ihre möglichen Merkmale im neuen System zusammen:
Kategorie | Eigenschaften (im neuen US-System) |
|---|---|
Grün (Verbündete) | – Niedrige/keine US-Zölle, privilegierter Zugang zum US-Markt – Bevorzugter Zugang zum US-Finanzsystem (Dollar-Liquidität) – US-Sicherheitsgarantien (Militärschutz), evtl. gegen Kostenbeteiligung |
Gelb (Neutral) | – Normale Handelsbeziehungen ohne Sonderprivilegien – Möglichkeit zu bilateralen Abkommen mit den USA, aber keine automatische Bevorzugung – Weder umfassende Vorteile noch aktive Benachteiligung durch die USA (Zwischenstatus) |
Rot (Gegnerisch) | – Hohe US-Zölle und Handelsbarrieren, vom US-Markt weitgehend ausgeschlossen – Kein bevorzugter Zugang zum US-Finanzsystem (evtl. Sanktionen, Dollar-Abkopplung) – Keine Sicherheitskooperation mit den USA; muss auf eigene Bündnisse setzen |
Beispiele: In Trumps Konzept wären klassische Alliierte wie Kanada, Westeuropa, Japan, Südkorea etc. als grüne Länder vorgesehen. Gelb könnten viele Schwellenländer oder blockfreie Staaten sein, die weder eng verbündet noch explizit feindlich sind (etwa Südostasien, Lateinamerika, vielleicht auch die Golfstaaten). Rot wäre allen voran China, aber wohl auch Russland, Iran und andere, die als Gegner gelten.
Derzeitige Tendenzen: Viele traditionelle US-Verbündete zeigen sich verunsichert, sind aber (noch) nicht bereit, die Fronten zu wechseln. In der EU etwa herrscht intern Uneinigkeit, wie man auf Trumps Zollschläge reagiert. Die EU-Kommission sprach von der Notwendigkeit, zurückzuschlagen, doch Schlüsselländer wie Deutschland und Frankreich – selbst mit eigenen politischen Problemen beschäftigt – bevorzugen bislang eine abwartende, deeskalierende Linie. Anstatt unmittelbar Vergeltungszölle zu erheben, setzen sie auf Verhandlungen, um niedrigere Zölle oder Ausnahmen für kritische Branchen zu erreichen. Zugleich wird betont, man behalte sich Gegenmaßnahmen vor, falls Washington nicht einlenkt. Diese vorsichtige Haltung deutet darauf hin, dass Europa prinzipiell im US-Lager bleiben will (schon aus sicherheitspolitischer Abhängigkeit), aber die Rolle des fügsamen „grünen“ Vasallen nur ungern akzeptiert. Vor allem die Vorstellung, für US-Schutz „Tribut“ zu zahlen oder die eigene Währung nach Washingtons Wünschen zu steuern, ruft Widerstände hervor – das erinnert viele Europäer an ungleiche Machtverhältnisse vergangener Zeiten. Allerdings könnte die wirtschaftliche Realität die EU zu Kompromissen zwingen: Europa exportiert viel in die USA und möchte einen Handelskrieg unbedingt vermeiden. Daher sind punktuelle Zugeständnisse denkbar – etwa stärkere Rüstungsbeiträge (Stichwort NATO-Ziel 2% vom BIP) oder Abkommen zur Regulierung Chinas (Investitionskontrollen, Technologien), um sich grün zu qualifizieren, ohne es so zu nennen.
Japan und Südkorea befinden sich in ähnlicher Lage. Beide sind sicherheitspolitisch komplett auf die USA angewiesen (nukleare Schutzschirme gegen Nordkorea/China) und haben bereits in der Vergangenheit auf Druck der USA Aufwertungen ihrer Währungen akzeptiert (Plaza/Louvre-Abkommen). Wahrscheinlich würden Tokio und Seoul letztlich beim „Mar-a-Lago-Accord“ mitziehen, falls er in einen multilateralen Rahmen gegossen wird. Kurzfristig haben auch sie jedoch Zölle abbekommen und protestiert. Japans Diplomatie dürfte bemüht sein, eine Sonderbehandlung auszuhandeln – eventuell über die QUAD-Allianz (USA-Japan-Indien-Australien) oder andere Kanäle, um schrittweise ins grüne Lager zu gelangen, ohne öffentlich das Gesicht zu verlieren.
Kanada und Mexiko waren als direkte Nachbarn ein Sonderfall: Sie blieben von den pauschalen Zöllen am 2. April (10% auf fast alle Länder) zunächst ausgenommen , da sie über das neue USMCA-Abkommen tief in US-Lieferketten integriert sind. Trump nutzte hier eher andere Druckmittel – so drohte er mit separaten 25%-Zöllen ab Februar 2025, um Mexiko zur Drogenbekämpfung zu drängen. Die Botschaft an Ottawa und Mexiko-Stadt ist klar: Ihr könnt zwar grün bleiben, aber nur, wenn ihr politisch spurt. Beide Länder versuchen, dem offensiv zu begegnen (Mexiko verstärkt z.B. die Fentanyl-Bekämpfung, Kanada lobbyiert in Washington für Ausnahmen). Da ihre Wirtschaftsschicksale so eng mit den USA verflochten sind, bleibt ihnen kaum eine Wahl als sich ins neue System einzufügen – aber die harte Gangart der USA könnte innenpolitischen Unmut schüren und langfristig anti-amerikanische Stimmungen verstärken.
Auf der anderen Seite formiert sich eine lose Gruppe von Ländern, die nicht bereit sind, Trumps Ordnung zu akzeptieren. Russland ist durch westliche Sanktionen ohnehin isoliert und rückt enger an China heran – beide deklarieren eine „grenzenlose“ Partnerschaft gegen die von den USA dominierte Welt. Iran und teilweise Türkei orientieren sich ebenfalls Richtung Osten/BRICS. Überraschenderweise hat selbst Brasilien – ein traditioneller US-Partner – unter Präsident Lula signalisiert, man wolle die Dollar-Dominanz etwas verringern. Als Brasilien 2025 den Vorsitz der BRICS führte, stellte es jedoch klar, dass es keine gemeinsame Währung einführen will (damit nicht direkt Trumps Zorn provozieren), aber sehr wohl den Handel in lokalen Währungen erleichtern möchte. So sollen alternative Zahlungssysteme und digitale Technologien geprüft werden, um global unabhängiger vom Dollar zu werden. Lula betonte, dies richte sich „gegen niemanden“ – doch allein die Tatsache, dass große Schwellenländer solche Schritte diskutieren, zeigt ein Unbehagen mit der US-Zentralität.
Viele Länder des globalen Südens fühlen sich zudem zwischen die Fronten gedrängt. Singapurs Premier erklärte gar, die bisherige Weltordnung sei „am Ende“, und kleine Staaten müssten sich auf harte bilaterale Verhandlungen einstellen, da Regeln und Normen erodieren. Einige dieser Staaten könnten versucht sein, sich dem chinesischen Einfluss zuzuwenden, falls die USA sie zu schlecht behandeln. Andere halten still und hoffen, dass die Großmächte ihre Rivalität nicht auf ihrem Rücken austragen.
Unterm Strich ist derzeit kein großer Andrang zu Trumps neuem Club erkennbar – aber auch kein Massenexodus aus dem US-Lager. Vielmehr sortieren sich die Akteure entlang ihrer Interessen: Wer stark von den USA abhängt oder profitieren kann (z.B. Indien), sucht Arrangement; wer sich benachteiligt oder bedroht fühlt (China, Russland), bildet Gegenpole. Dazwischen lavieren viele, um Nachteile zu minimieren. Die echte Nagelprobe steht jedoch erst noch aus: Wird es Trump gelingen, ein formelles „Mar-a-Lago-Abkommen“ auszuhandeln, und wer würde es unterzeichnen? Bislang ist das hypothetisch. Doch schon die Positionierungen verraten die Tendenzen: Ein mögliches Währungs- und Sicherheitspakt würden vermutlich die USA und ein Kern von Verbündeten (Europa, Japan, Five Eyes) tragen müssen. Sollten diese sich untereinander einig werden, könnte das neue System genügend Zugkraft entwickeln, um andere neutralere Staaten mit hineinzuziehen – etwa durch wirtschaftliche Anreize. Verweigern jedoch selbst enge Partner wie Deutschland oder Japan die Gefolgschaft, dürfte das „Bucket“-System nicht viel mehr werden als ein grobes Druckinstrument ohne breite Akzeptanz.
Risiken und Folgen bei einem Scheitern der Strategie
Was, wenn Trumps großer Plan scheitert? Dieses Szenario ist keineswegs ausgeschlossen – es genügt, dass genügend Länder nicht mitspielen. Die möglichen wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen wären weitreichend:
Fortgesetzte Fragmentierung des Welthandels: Sollte kein neues Abkommen zustande kommen, blieben die erhöhten Zölle und Gegenmaßnahmen möglicherweise auf unbestimmte Zeit in Kraft. Die Welt könnte in handelspolitische Blöcke zerfallen – ein US-geführter Block vs. ein China/BRICS-geführter, während viele kleinere Länder dazwischen aufgerieben werden. Das multilaterale Handelssystem (WTO) wäre de facto obsolet. Diese Entwicklung erinnert gefährlich an die 1930er Jahre, als Protektionismus und Blockbildung die Weltwirtschaft strangulierten. Erste Analysen vergleichen Trumps Störfeuer bereits mit der Weltwirtschaftskrise jener Zeit. Ein Scheitern seiner Strategie könnte eine globale Rezession auslösen, da Lieferketten durcheinandergeraten und Investitionen wegen unsicherer Handelsbedingungen zurückgehen.
Entweder Dollar-Privileg oder Industrie – ein Zwangsentscheid: Ohne Mar-a-Lago-Deal stünde Trump vor dem Dilemma, das er eigentlich lösen wollte. Option 1: Er hält am Dollar als Leitwährung fest (indem er z.B. keine radikalen Abwertungsaktionen unternimmt). Dann bliebe aber auch der Dollar tendenziell stark, und die Reindustrialisierung käme kaum vom Fleck. Die USA müssten weiter mit hohen Importüberschüssen leben und sich darauf verlassen, dass Rivalen wie Mexiko, Vietnam, Europa ihre Konsumgüter liefern. Das von Trump beklagte Machtungleichgewicht – eine „Service-Wirtschaft“ USA versus eine „Werkbank“ China – würde bestehen bleiben. Option 2: Trump entscheidet sich, den Dollar doch spürbar abzuwerten (z.B. durch Geldpolitik oder Kapitalverkehrskontrollen), um industrielle Vorteile zu erlangen – riskiert damit aber, dass der Dollar seinen Reservewährungsstatus einbüßt. Denn ohne internationales Einvernehmen könnten Großanleger das Vertrauen verlieren. Wenn der US-Dollar nicht mehr als verlässlich gilt, würden Zentralbanken und Fonds auf Euro, Gold oder andere Assets umschichten. Die USA verlören ihr exorbitantes Privileg: Sie müssten ihre Importe wieder erdienen und könnten nicht mehr unbegrenzt Defizite fahren, ohne dass die eigene Währung einbricht. Trump selbst hat dieses Szenario als fatal beschrieben („Verlust des Reserve-Status = Abstieg zur Dritten Welt“) . Doch ein ungeordnetes Schwächen des Dollars könnte genau das bewirken.
Geopolitische Machtverschiebung: Scheitert Trumps Vorstoß, könnte das langfristig die Machtbalance verschieben. Wenn kein westlich dominiertes Abkommen zustande kommt, haben Länder wie China freien Spielraum, eigene Initiativen zu stärken. Die BRICS-Staaten etwa könnten ihre Kooperation intensivieren – vielleicht keinen vollwertigen Ersatz für den Dollar schaffen, aber doch regionale Finanzstrukturen, die den Westen umgehen. Sollten die USA als unzuverlässiger Partner dastehen, könnte dies traditionelle Allianzen untergraben. Einige Staaten könnten sich sicherheitspolitisch stärker emanzipieren (Europa etwa durch Aufbau autonomer Verteidigungskapazitäten, um US-Druck zu entgehen). Andere könnten sich China annähern, das seinerseits alternative Sicherheits- und Wirtschaftsangebote macht. Im Worst Case entstünde eine Welt, in der die USA zwar noch wirtschaftlich und militärisch stark sind, aber isolierter als zuvor – ein Hegemon ohne Gefolge. Dies würde auch die globale Durchsetzungsfähigkeit Amerikas schwächen, z.B. bei Sanktionen oder in der Diplomatie, da weniger Länder bereit wären, US-Vorgaben zu folgen.
Binnenwirtschaftliche Verwerfungen: Nicht zu vergessen: Sollte Trump mit leeren Händen dastehen (keine Deals, anhaltender Handelskrieg), hätte er innenpolitisch ein Problem. Die anfänglichen Opfer (höhere Preise, Exportverluste bei Bauern und Industrien, Börsenverluste) hätten sich dann nicht ausgezahlt. Die US-Wirtschaft könnte in eine Stagflation rutschen: hoher Inflation durch Zölle, aber stagnierende Industrieproduktion mangels neuer Märkte. Das würde Trumps Anhängerschaft (Rust Belt) hart treffen und politischen Gegenwind erzeugen. Proteste und Unzufriedenheit könnten steigen – erste Demonstrationen gegen die Regierungspolitik gibt es bereits . Die tiefe Polarisierung der US-Gesellschaft könnte sich weiter verschärfen, insbesondere wenn Trump die Schuld für das Scheitern bei „illoyalen“ Eliten oder Auslandssündenböcken sucht.
In Summe stünde die Trump-Administration vor einer ungemütlichen Wahl: Entweder sie hält am Status quo fest (Dollar bleibt stark, Industrie bleibt schwach) – was dem Wahlversprechen „Make America Manufacturing Great Again“ zuwiderliefe – oder sie bricht den Status quo (opfert den starken Dollar) und riskiert Amerikas globalen Finanzvorsprung. Beide Optionen wären ein Rückschritt gegenüber dem ambitionierten Ziel, beides zu haben. Genau diese Möglichkeit hatte Miran im Vorfeld ja in Aussicht gestellt – doch ohne internationale Kooperationsbereitschaft läuft es eben auf das klassische Dilemma hinaus .
Realismus und potenzielle Auswirkungen auf Handel, Dollar und Geopolitik
Donald Trumps drei-stufige Wirtschaftsstrategie stellt den kühnsten Versuch seit Jahrzehnten dar, die Spielregeln des Welthandels neu zu schreiben. Sie entspringt einer Diagnose, die viele Teile der US-Bevölkerung teilen: Die globale Ordnung der letzten 40 Jahre hat Amerikas Industrie schrumpfen und Rivalen erstarken lassen. Der Plan von Bassett und Miran will diesen Trend umkehren und gleichzeitig Amerikas finanziellen Vorteil (den Dollar) retten – eine Herkulesaufgabe, an der sich die Geister scheiden.
Ist die Strategie realistisch? Nur bedingt. Aus historischer Sicht war die Schaffung eines neuen Systems (Bretton Woods) oder auch dessen Anpassung (Plaza Accord) nur unter besonderen Umständen möglich – nämlich mit den USA in der Führungsrolle, aber auch im Einvernehmen mit wichtigen Partnern. 2025 jedoch wirken die USA innenpolitisch erratisch und außenpolitisch weniger vertrauenswürdig als in früheren Epochen. Viele Länder zweifeln an der Konstanz amerikanischer Zusagen über Wahlperioden hinweg. Trumps harter Ansatz – erst Chaos stiften, dann zur Ordnung rufen – könnte zwar am Verhandlungstisch Erfolge erzwingen, lässt aber Goodwill vermissen, der für langfristige Bündnisse nötig ist .
Dennoch darf man den Plan nicht vorschnell als „verrückt“ abtun. Er ist in sich logisch aufgebaut und fußt auf konkreten historischen Analysen und ökonomischen Theorien. Sollte Trump bestimmte Staaten ins Boot holen (etwa Indien, einige G7-Partner) und zumindest ein informelles Abkommen über Währungskoordinierung erreichen, könnten sich tatsächlich Teilerfolge einstellen: Der Dollar würde moderat nachgeben, US-Exporte zögen an, und einige Industriezweige kehrten heim. Global sähe man wohl eine Blöcke-Bildung: Auf der einen Seite ein US-geführter Verbund mit intensiver Handels-, Währungs- und Sicherheitsverflechtung (grüner Club), auf der anderen Seite ein chinesisch beeinflusster Kreis sowie zahlreiche Non-Aligned-Staaten, die zwischen beiden lavieren. Der Welthandel würde dann weniger allgemein multilateral ablaufen, sondern stärker über bilaterale Pakte und Absprachen kanalisiert – ein Rückschritt gegenüber der liberalen Globalisierung, aber vielleicht stabiler als völliges Chaos. Der US-Dollar bliebe vorerst Leitwährung, doch möglicherweise entstünden parallele Finanzsphären: ein Dollar-Raum und ein Yuan/BRICS-Raum, mit begrenzten Schnittstellen. Geopolitisch könnte das neue System Amerikas Vormacht festigen, wenn genug Nationen daran teilnehmen – es wäre im Grunde eine Art neo-imperiales Gefüge, bei dem die USA Schutz und Markt bieten und im Gegenzug Loyalität und wirtschaftliches Entgegenkommen verlangen. Das würde die bisherigen Machtverhältnisse zementieren, allerdings zum Preis einer gewissen Offenheit und Souveränität der Partner.
Gelingt es Trump jedoch nicht, genügend Gefolgschaft zu mobilisieren, droht ein weniger geordnetes Outcome: Handelskriege ohne Ende, eine geschwächte Welthandelsorganisation, ein nervöses Nebeneinander verschiedener Währungsblöcke – kurz: Unsicherheit als neuer Normalzustand. Das würde das Wachstum weltweit dämpfen und allen schaden, auch den USA. Ironischerweise könnte in einem solchen Szenario das erreichen, was er verhindern wollte: Länder diversifizieren weg vom Dollar, schließen regionale Bündnisse aus Misstrauen gegen Washington und machen damit die USA auf lange Sicht weniger einflussreich.
Im Moment ist die Zukunft des Plans offen. Fest steht: Die kommenden Monate und Jahre werden von intensiven Verhandlungen geprägt sein – teils an offiziellen Konferenztischen, teils hinter den Kulissen. Man wird Kompromisse schmieden, rote Linien austesten und neue Allianzen knüpfen (oder alte lösen). Aus Sicht eines neutral-analytischen Beobachters bleibt anzumerken, dass extreme Szenarien selten vollständig eintreten. Weder ein vollständiger Triumph Trumps (mit Dollar-Flaute und trotzdem Dollar-Hegemonie) noch ein komplettes Scheitern (US verliert alles) sind vorgezeichnet. Wahrscheinlicher sind Zwischenergebnisse: gewisse Neuausrichtungen im Handel, eine leichte Anpassung der Währungsrelationen, aber auch fortbestehende Rivalitäten. Für den globalen Handel könnte dies bedeuten, dass er kurzfristig holpriger wird – mit mehr Zöllen, Kontrollen und politischen Eingriffen – aber mittelfristig neue Gleichgewichte findet, etwa durch regionale Abkommen als Ersatz für weltweite Regeln. Die Rolle des US-Dollars dürfte auf absehbare Zeit groß bleiben, selbst wenn er etwas an Wert verliert; zu stark sind die institutionellen und marktmäßigen Netzwerke um den Greenback. Allerdings könnte sich seine Dominanz langsam weiter erodieren, falls Vertrauensbrüche auftreten und Alternativen reifen (Euro, Yuan, digitale Währungen). Die geopolitischen Machtverhältnisse schließlich werden sich je nach Ausgang neu justieren: Ein erfolgreicher Trump-Deal würde die USA als wirtschaftliche Ordnungsmacht rehabilitieren, während ein Fehlschlag die Welt wohl multipolarer und unberechenbarer machen würde.
Als Beobachter sollte man nüchtern festhalten: Trumps Strategie ist ein hochriskantes Spiel, das im Erfolgsfall ein neues Kapitel der US-Vorherrschaft einleiten könnte – im Misserfolgsfall aber Amerikas Stellung und die globale Stabilität unterminiert. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob das „Zollchaos“ und Visionen eines Mar-a-Lago-Abkommens zu einer nachhaltigen Neuordnung führen oder als ambitionierter Fehlversuch in die Geschichte eingehen. In jedem Fall hat die Diskussion darüber bereits eines bewirkt: Sie rückt die Fragen von fairen Handelsregeln, Währungsungleichgewichten und globaler Wirtschaftsgovernance wieder ins Zentrum der weltweiten Debatte – Themen, die in einer globalisierten, aber zunehmend konkurrierenden Weltordnung wichtiger denn je sind.
Foto: Zoshua Colah on Unsplash
Hier findest du eine vereinfachte Erklärung des Artikels, die es leichter macht, das Thema zu verstehen. Perfekt für alle, die eine kürzere und verständlichere Version bevorzugen!
Trumps Plan für die Wirtschaft
Donald Trump hat einen sehr komplizierten Plan, um die Wirtschaft der USA zu verändern. Viele denken, dass er einfach nur Chaos macht – Zölle auf alle Länder, auch auf seine Verbündeten. Aber er hat einen Plan, der in drei Teile gegliedert ist. Hier erkläre ich, wie dieser Plan funktioniert, was er erreichen will und warum er das Ganze macht.
Was ist der Plan?
Trump und sein Team, vor allem seine Berater Scott Bassett und Stephen Miran, haben einen Plan, um die Wirtschaft der USA zu stärken und den US-Dollar weiterhin als die wichtigste Währung der Welt zu behalten. Der Plan besteht aus drei Phasen:
Zölle als Druckmittel:
Trump hat hohe Zölle auf Waren aus anderen Ländern erhoben, sowohl auf Produkte aus Ländern, mit denen er befreundet ist, als auch auf die von seinen Feinden. Diese Zölle soll er als Druckmittel verwenden, um andere Länder zu zwingen, bessere Handelsbedingungen mit den USA auszuhandeln.
Gegenseitige Zölle:
In der zweiten Phase geht es darum, dass alle Länder die gleichen Zölle auf die Waren des anderen erheben. Wenn ein Land zum Beispiel Zölle auf US-Waren erhebt, wird die USA sofort die gleichen Zölle auf die Waren dieses Landes anwenden. Ziel ist es, fairere Handelsbedingungen zu schaffen.
Neues Währungsabkommen:
Am Ende will Trump ein großes Abkommen erreichen, bei dem der US-Dollar weiterhin die wichtigste Währung bleibt, aber die USA ihn gezielt abwerten, damit ihre Produkte billiger werden. Im Gegenzug sollen andere Länder dann leichteren Zugang zum US-Markt haben und die USA unterstützen, zum Beispiel mit Militärschutz.
Warum ist dieser Plan so wichtig?
Trump sieht die Deindustrialisierung der USA als ein großes Problem. In den 1950er Jahren war die Industrie noch ein sehr wichtiger Teil der US-Wirtschaft, aber heute ist sie viel kleiner. Viele Fabriken wurden in andere Länder verlagert, weil die Arbeitskräfte dort billiger sind. Das hat viele Arbeitsplätze in den USA gekostet und ganze Regionen der USA in Armut gestürzt.
Trump glaubt, dass die USA wieder mehr Fabriken brauchen, um ihre Wirtschaft zu stärken und weniger von anderen Ländern abhängig zu sein. Aber viele Experten sagen, dass das nicht einfach ist, weil die USA einen starken Dollar haben, der normalerweise die Exporte teurer macht. Doch Trump denkt, er kann diesen Widerspruch auflösen, indem er den Dollar kontrolliert und gleichzeitig eine starke Industrie wieder aufbaut.
Was ist der Unterschied zu früheren Abkommen?
Die USA haben in der Vergangenheit bereits die Weltwirtschaft verändert, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem sogenannten Bretton-Woods-Abkommen, wo viele Länder ihre Währungen an den US-Dollar gebunden haben. Trump versucht etwas Ähnliches, aber diesmal geht es darum, den Dollar zu schwächen, ohne seine Rolle als Weltreservewährung zu verlieren.
Wird es funktionieren?
Ob Trumps Plan funktioniert, hängt davon ab, ob genug Länder mitmachen. In der Vergangenheit haben Länder den USA gerne geholfen, weil sie von den Vorteilen des US-Marktes und des US-Dollars profitiert haben. Doch heute gibt es auch viele Länder, die sich weniger auf die USA verlassen wollen, zum Beispiel China und Indien. China wird sich wahrscheinlich nicht leicht in Trumps System einfügen, weil es wirtschaftlich selbst immer stärker wird. Indien hingegen sieht in Trumps Plan eine Chance, da die indischen Produkte durch die Zölle auf chinesische Waren relativ günstiger werden könnten.
Die größte Frage ist also: Werden genug Länder mit Trump zusammenarbeiten, um ein neues Wirtschaftssystem zu schaffen, das den USA zugutekommt, oder wird der Plan scheitern und zu noch mehr Konflikten führen?
Ein großes Risiko
Trumps Plan ist riskant. Sollte er scheitern, könnte die Weltwirtschaft noch chaotischer werden. Länder könnten sich voneinander abkapseln und den Welthandel gefährden. Sollte der Plan jedoch erfolgreich sein, könnte es den USA helfen, wieder eine starke industrielle Basis aufzubauen und gleichzeitig den US-Dollar als die führende Weltwährung zu behalten. Aber das ist ein sehr unsicherer Plan, und es wird sich zeigen müssen, ob er funktioniert.